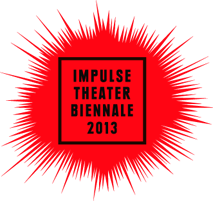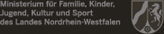Der postethnische Homosexuelle und die Ambivalenz der Identifikation
19 Juni 2013
von WENZEL BILGER
„Also, wenn du Türken kennst, dann weißt du, alles ist dramatisch, alles, wir müssen überall totales Drama daraus machen. Ist immer so, entweder viel weinen, viel hineinsteigern, Türken halt.“ (Mesut, schwuler Berliner mit Eltern aus der Türkei)
Seit den 1990ern entwickelt sich in westdeutschen Städten und Berlin eine Subkultur Nicht-Heterosexueller türkischen Hintergrunds: Partys mit besonderen Musik- und Performance-Stilen sowie politische Projekte sind entstanden. „Gayhane“, queere türkische Popmusik, Drag-Bauchtanz haben in Berlin inzwischen Geschichte. Aber auch die politische Öffentlichkeit interessiert sich zunehmend für eine Gruppe, die gleichzeitig zwei Minderheiten angehört: Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland unterhält ein Migrantenprojekt, alternative Vereine haben sich gegründet. Auch Film und Theater haben nicht-heterosexuelle Berliner, v. a. Männer, mit türkischem Migrationshintergrund als Protagonisten entdeckt. Meist bauen die Figuren allerdings auf klassischen Stereotypen aus Stricher- und Drogenmilieu auf und die Geschichten enden tragisch wegen einer vermeintlichen Unvereinbarkeit zwischen einem schwulen Identitätsmodell einerseits und einem türkischen andererseits.
Repräsentiert, im Sinne von dargestellt, werden „schwule Deutschtürken“ auch im Theater. (Die Bezeichnung „schwule Deutschtürken“ ist aus verschiedenen Gründen unzutreffend, denn die meisten sind eher deutsch als türkisch). Die Bühne ermöglicht die Darstellung einer „Identitätskultur“ vor Publikum. Die Repräsentation von kulturellen Machtverhältnissen und deren Niederschlag in Identitäten in Fernsehen, Film, Theater und Diskursen bekommt in unseren Gesellschaften zunehmende Bedeutung. Vielleicht kommt ihr auch für gesellschaftliche Veränderungen eine zentralere Bedeutung zu, als wir uns das bisher vorstellen können. Kultur ist Politik.
Das Berliner HAU etwa brachte Anfang Mai 2008 das Stück „Jenseits – Bist du schwul oder bist du Türke?“ auf die Bühne. Der Text speist sich aus Interviews, die die Autoren Nurkan Erpulat und Tunçay Kulaoğlu mit Schwulen türkischen und kurdischen Hintergrunds geführt haben und ist geprägt von den Ambivalenzen und Spannungen mehrfacher Identitätszuschreibungen.
Die Darstellung einer doppelt marginalisierten, also (post-)migrantischen und sexuell abweichenden Erfahrung auf dramatische und/oder dokumentarische Art und Weise trägt auch zur Legitimierung sozialer Bewegungen bei, da persönliche Erfahrungen dramaturgisch nachvollziehbar gemacht werden. Kultur ist Politik, denn Politik ist immer auch die Übernahme von Perspektiven. Die Angebote der Populärkultur, aber auch des Theaters, wo es sich gesellschaftlicher Themen annimmt, stehen so in engem Zusammenhang mit wesentlichen Vorstellungen von Identität und sozialer Position. Das Theater stellt einen Raum dar, in dem soziale Handlung und Interaktion und damit auch die Konstitution von Identität aufgegriffen und dargestellt werden. Das Publikum sieht und beobachtet die darin repräsentierten Rollenbilder, so stereotyp oder dekonstruktivistisch sie auch sein mögen. Es hat die Möglichkeit, durch die Reflexion der auf der Bühne dargestellten Identitätsarbeit, die eigene personale Identität abzugleichen und zu evaluieren und sich möglicherweise sogar kollektiv von Haupt- und Nebenfiguren abzugrenzen.
Mehrfache Identitätszuschreibungen entsprechen der Norm. Lebensläufe und Identitäten werden immer weniger national geprägt, sondern orientieren sich an einer sich über Grenzen ausdehnenden, globalisierten Gesellschaft. Es gibt immer mehr Diaspora, sie ist überall. Wir sind meistens nicht da, wo wir herkommen, also an dem Ort an dem das Identitätsmodell, auf das wir uns beziehen, „das einzige“ oder das herrschende ist. Und damit multiplizieren sich die Identitätskulturen. Wir berufen uns auf verschiedene Sinnelemente und Orientierungsmuster unterschiedlicher historischer, geografischer und semantischer Herkunft, immer wieder neu. Das ist Identitätsarbeit.
Ethnizität ist nur ein Aspekt von vielen, die diese wuchernden Identitätskulturen prägen. Identitäten entstehen und wachsen in einem Kräftefeld, das sich durch Überschneidungen unterschiedlicher Kategorien ergibt, die unsere Gesellschaft prägen: Neben Ethnizität sind dies etwa auch Klasse, Geschlecht, sexuelle Orientierung. Sie bestimmen die soziale Stellung eines Individuums und strukturieren unsere gesellschaftliche Wirklichkeit oder besser: Wirklichkeiten.
Schwule Männer in Deutschland mit türkischem Hintergrund sind sowohl ethnisch als auch sexuell anders. Sie werden generell sowohl als Nachkommen von Einwanderern aus der Türkei als auch als von der heterosexuellen Norm abweichend wahrgenommen und kategorisiert. In ihrem Selbstverständnis und ihrer alltäglichen Identitätsarbeit, also in der Praxis, ist das aber deutlich komplizierter. Hegemoniale Diskurse und Zuschreibungen sind klar und eindeutig. Identifikationen mit ihnen, die alltägliche Praxis, sehr viel weniger.
Jede soziale Situation im Bezug auf Zugehörigkeit zu einer „Gruppe“ ist für schwule Männer mit Migrationshintergrund von starken Ambivalenzen geprägt. Nun wird Identität nie ein für alle Mal, sondern immer wieder mehr oder weniger erfolgreich performativ „hergestellt“. Die Ambivalenzen multiplizieren sich in der wiederholenden Struktur, durch die jede Konstitution von Identität sich auszeichnet. Der „schwule Deutschtürke“ ist nie ein für alle Mal „türkisch“ (auch nicht ein für alle Mal „schwul“), sondern er nimmt diese Identität („Türke” zu sein) immer wieder an und weist sie zurück. „Schwule Deutschtürken“, um noch einmal diese problematische Bezeichnung zu verwenden, verfolgen in der Identitätskonstitution häufig widersprüchliche Strategien / Performances.
Die genannte Ambivalenz bezieht sich sowohl auf Momente, in denen man sich selbst als Türke darstellt, als auch auf Situationen, in denen die anderen, also die Gruppe der Einwanderer, der „Parallelgesellschaft” als Türken bezeichnet werden. Der Rückgriff auf und der besondere Umgang mit bestimmten Stereotypen in den Diskursen der Mehrheitsgesellschaft, z. B. des „Gastarbeiter“-Diskurses, zeigt diese Ambivalenz besonders deutlich: Manchmal ent-ethnisiert sich ein „schwuler Deutschtürke“ durch die Projektion von diskriminierenden Zuschreibungen auf die Gruppe der „anderen Türken“: Da wird die Familie als türkisch (traditionell, konservativ, etc.) bezeichnet, während man sich selbst dieser Zugehörigkeit verweigert. Manchmal aber nutzt man Klischees der Ethnizität, um sich interessant zu machen. Türke zu sein kann sich in bestimmten Zusammenhängen als nützlich erweisen, wenn man etwa den stereotypen Erwartungen an einen südländischen Liebhaber entsprechen möchte (um sein eigenes sexuelles Ziel zu erreichen).
In jeder Situation ist die Zugehörigkeit wenig eindeutig. Die Summe all dieser Ambivalenzen kann als „postethnisch“ bezeichnet werden. Die Erkenntnis, dass jede Zugehörigkeit immer wieder neu und anders und nie ganz vollständig hergestellt wird, verabschiedet sich nämlich gänzlich von der Vorstellung einer homogenen dauerhaft bestehenden „ethnischen Gruppe“. „Die Türken“ gibt es nicht. Die „Schwulen“ vielleicht schon eher?
Es scheint in Deutschland normaler schwul zu sein als Türke zu sein, was auch mit den Debatten der letzten Jahre um Parallelgesellschaften, Islam, Sicherheit und Terrorismus zu tun hat. Einwanderer, anderer Hautfarbe oder Muslim zu sein, ist in der Öffentlichen Meinung nach wie vor „nicht richtig deutsch”.
Ein schwuler Deutschtürke kann ein ganz gewöhnlicher Homosexueller werden, vorausgesetzt, er erhält in der sozialen Interaktion die Ambivalenzen aufrecht, die seine „ethnische Zugehörigkeit“ relativieren und unterminieren, sie also in Frage stellen. Er darf also nie ganz „Türke“ sein. Das heißt, dass er sich mit jeder Selbstethnisierung immer auch seiner Ethnizität entledigen muss, um an den Integrationsprozessen teilzunehmen, die ihm als Homosexueller ermöglicht werden. Türke darf er nur ein bisschen sein, Schwuler ganz (zumindest manchmal).
Das Verhältnis zwischen Identität und Gemeinschaft steht also insgesamt auf dem Spiel und bestehende Gruppengrenzen verschwimmen. Die Nachkommen türkischer Einwanderer nehmen an unterschiedlichen Welten teil. Von einer Gruppe, kann keine Rede sein (schon gar nicht von einer Parallelgesellschaft).
Politik, Veränderung und Handlungsfähigkeit können also nicht in einer vorgestellten „Gruppe“ liegen, sondern müssen in der täglichen Identitätsarbeit, in ihrer Repräsentation, in der Performance liegen, vielleicht also auch im Theater. Und ein ganz spezifischer Moment der Identitätsarbeit des postethnischen Homosexuellen scheint hier besonders interessant: Der Moment nämlich, in dem beide Kollektivierungspraxen, nämlich „schwul“ und „türkisch“ zu sein, bzw. sich so darzustellen, ambivalent, ironisch, überspitzt und übertrieben verschränkt werden; stilistisch überpointiert, als Camp.
Wie Mesut (Name geändert), schwuler Berliner mit Eltern aus der Türkei, sagt: „Also, wenn du Türken kennst, dann weißt du, alles ist dramatisch, alles, wir müssen überall totales Drama daraus machen. Ist immer so, entweder viel weinen, viel hineinsteigern, Türken halt.“
Die Aussage, die den Sprecher zum „Türken“ macht ist hier einerseits ironisch überhöht und andererseits ist ihr etwas ganz anderes eingeschrieben: Nämlich die Semantik der Stereotypisierung sexueller Abweichung bei Männern, und zwar in ihrer Verdichtung in der Figur der „Dramaqueen“. Es fallen hier zwei unterschiedliche Performative der Zuschreibung kollektiver Identität zusammen, die Aussage schießt doppelt über das Ziel hinaus. So viel „türkisch“ und so viel „Drama“ geht gar nicht. Jeder Sprechakt unterläuft die Absicht des jeweils anderen und hindert ihn so an seinem Gelingen. Der Sprecher ist Türke und Dramaqueen gleichzeitig, und damit keines von beiden richtig. Der postethnische Homosexuelle, in diesem Fall Mesut, gibt in diesem Moment die Eindeutigkeit seiner doppelten Zuordnung auf und spielt ein ambivalentes, post-identitäres Spiel: Identität wird unmöglich, wenigstens für einen Moment. Erst nach dieser Praxis der (Anti-)Identifikation, des Camp, stabilisiert sich seine gesellschaftliche Position wieder im Rückgriff auf konventionellere, hegemoniale Ordnungsangebote, als Türke oder als Schwuler.
Literatur: Wenzel Bilger (2012) Der Postethnische Homosexuelle: zur Identität „schwuler Deutschtürken”. Bielefeld: transcript.
Wenzel Bilger leitet die Programmabteilung des Goethe-Instituts New York und die kulturellen Aktivitäten des Goethe-Instituts in den USA, Kanada, Mexiko und Kuba. Er arbeitet an internationalen Projekten mit Künstlern, Kuratoren und Wissenschaftlern. Wissenschaftliche Schwerpunkte sind Fragen der Ethnizität, Geschlecht und Sexualität sowie „Identität” in liberalen Gesellschaften.